KH-IT-Pressereferent Flemming bringt es auf den Punkt: „Ein schlechter analoger Prozess ist nach der Digitalisierung nur ein schlechter digitaler Prozess.“ Deshalb müsse das KHZG mehr sein als ein reines Förderinstrument, ist Marx überzeugt. Hier seien nicht nur die Kliniken und Träger gefragt, sondern auch die Fachgesellschaften und politisch Verantwortlichen. Er fordert klare Zieldefinitionen, also eine definierte Marschrichtung, die aktuell noch fehle.
Wie genau die aussehen soll, darüber sind sich auch die Experten nicht unbedingt einig. Aktuell etwa fehlen bundesweite Standards für die Kopplung unterschiedlicher digitaler Systeme, jedes Bundesland setzt Reformen und Projekte selbstständig um. Bernhard Kumle spricht sich für eine Vereinheitlichung aus: „Gegebenenfalls müssten Software- und KIS-Hersteller dazu verpflichtet werden.“ DIVI-Präsident Marx hingegen sieht den Föderalismus auch als Chance, als eine Art Katalysator. Denn so ließen sich besonders mutige Entwicklungen als Vorbild-Projekte in andere Bundesländer tragen. Eine zentrale Entscheidungsstruktur sei möglicherweise deutlich langsamer.
Auch ein Blick in die Zukunft stimmt Kumle nachdenklich. Mit den Geldern aus dem Fonds könnten nun Geräte und Software angeschafft werden. Aber was ist nach dem Ende der Förderung? „Wir rechnen mit etwa 20 Prozent der Anschaffungskosten, die wir jährlich in die Wartung dieser Systeme investieren müssen“, sagt er. Software-Updates, der Austausch von veralteter Hardware nach einigen Jahren – die Folgekosten einer Digitalisierung seien immens. Kumles Fazit zum KHZG ist deshalb: „Es ist gut, dass es das gibt. Aber es muss auch klar sein, wie es danach weitergehen soll.“ Da bestehe noch Nachbesserungsbedarf.
KHZG: Chance – mit Einschränkungen
Nicht zu vergessen ist zudem, dass eine digitale Infrastruktur stets betreut werden muss. Für den Fall der Fälle sollte außerdem ein praktikables Ausfallkonzept vorliegen. Dafür braucht es Personal. Durch den KHZF können solche Stellen explizit mitfinanziert werden, aber auch hier nur bis zum Ende der Förderdauer von aktuell drei Jahren. Trotzdem hat etwa das Schwarzwald-Baar Klinikum zusätzliches Personal eingestellt. Das sorgt sich nun nicht nur um Rechner und Software, sondern schult auch die Klinikbeschäftigten im Umgang mit den neuen Systemen – eine zeit- und kostenintensive Aufgabe. Denn derartige Schulungen sind nicht im normalen Alltagsbetrieb machbar, die Beschäftigten müssen für diese Zeit von ihrer Arbeit freigestellt werden.
Trotz der Einschränkungen und der hier und da geäußerten Kritik sehen alle Gesprächspartner das KHZG dennoch als Chance, als richtigen und wichtigen Schritt in eine digitale Zukunft der Kliniken. Es könne vielen Digitalisierungs-Bemühungen – auch in den Notaufnahmen – einen entscheidenden Schub verpassen. Routineaufgaben ließen sich automatisieren, komplexe Aufgaben vereinfachen, ist etwa Jürgen Flemming überzeugt. Eine durchgehend elektronische Dokumentation minimiere etwa die Gefahr von Übertragungsfehlern und erleichtere die Auswertbarkeit von standardisiert gewonnenen Daten.
Vor allem aber soll die Digitalisierung die Arbeit erleichtern sowie Arbeitsbedingungen optimieren. „Gerade die Akutmedizin in den Notaufnahmen braucht immer auch engagierte Pflegende, die sich um kranke Menschen mit all ihren Sorgen und Nöten kümmern“, fasst DIVI-Präsident Marx zusammen. Die sollen und können auch gar nicht durch eine digitale Infrastruktur ersetzt werden. Aber automatisierte Dokumentationsprozesse und eine reibungslose Kommunikation zwischen allen Beteiligten – Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Klinik-Stationen – schaffen im optimalen Fall mehr Zeit und Raum für eine optimale Betreuung der Patientinnen und Patienten.



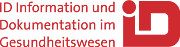



Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen