
Jeden Tag ist das Telefon eine Stunde lang das wichtigste Arbeitsgerät des Arztes Dr. Andreas Molitor. Er steht dann nicht an einem der Betten auf der Intensivstation des Evangelischen Stifts St. Martin in Koblenz oder eilt durch die Flure, sondern sitzt in einem ruhigen Büro und hört zu. Seit etwa einem Jahr bietet das Stift eine telefonische Angehörigensprechstunde an. Zwischen neun und zehn Uhr können die Familien der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus anrufen und bekommen sicher einen Arzt ans andere Ende der Leitung.
„Unsere Aufgabe am Telefon ist ein bisschen die eines Lotsen“, sagt der Facharzt für Anästhesiologie. Die Angehörigen würden mit unterschiedlichen Anliegen anrufen. „Der eine möchte wirklich erzählen, dann kann man sich auch mal zurücklehnen und zuhören. Andere wollen alles abfragen.“
Angehörige auf Informationen angewiesen
Schon länger war der Kontakt zu den Angehörigen ein Problem für die Ärzte im Stift. Intensivmedizin sei ein schwieriges Feld, weil die Patienten immer schwer krank seien und nicht immer überlebten, sagt Molitor. Umso mehr sind die Angehörigen auf die Informationen der Ärzte und Ärztinnen angewiesen. „Durch die Vielzahl der Telefonate morgens war unsere Stationssekretärin eigentlich komplett gebunden. Das funktionierte nur halbherzig zwischen Tür und Angel.“
Dabei sei der Austausch enorm wichtig, die Angehörigen brauche man als Partner in der Behandlung, sagt der Arzt. Dass es die Telefonsprechstunde aber tatsächlich in den Krankenhausalltag geschafft hat, ist eine Lehre aus der Corona-Pandemie. „Während Corona durften Angehörige dann gar nicht mehr kommen. Das war eine furchtbare Situation, für die Patienten, aber auch für die Angehörigen“, erinnert sich Molitor.
Telefonsprechstunde als reale Entlastung
Also führten sie die Telefonsprechstunde ein – zunächst noch mit Skepsis, ob sie überhaupt so viel Zeit zum Telefonieren erübrigen könnten. Doch die legte sich schnell, sagt Molitor. „Es ist eine reale Entlastung der Pflegenden und der Stationssekretärin und es ist eine geregelte Kontaktaufnahme.“
Seit dem rufen etwa sieben bis zwölf Menschen jeden Tag in dem zum GK-Mittelrhein gehörenden Krankenhaus an. Eine von ihnen war lange Zeit Gerlinde Blaese. Ihr Ehemann kam vergangenes Jahr auf die Intensivstation und blieb für etwa ein halbes Jahr. In dieser Zeit sei er gerade einmal drei Wochen ansprechbar gewesen – den Rest der Zeit lag er im Koma. „Er konnte mir also nichts berichten, ich war auf die Ärzte angewiesen.“
Sonst hat man das Gefühl, man ruft immer zur falschen Zeit an.
„Die Situation ist sowieso schrecklich. Da hilft es, einen Ansprechpartner zu haben“, sagte die 70-Jährige. „Ich konnte meine ganzen Fragen stellen: Wie war die Nacht, was ist der Plan für den Tag, wie sind die Laborwerte?“ Man habe durch die Sprechstunde die Gewissheit, dass man einen Arzt erwische. „Sonst hat man das Gefühl, man ruft immer zur falschen Zeit an.“
Es gebe sehr positive Rückmeldungen, sagt Molitor. „Weil wir eben in Ruhe Zeit haben, zu telefonieren.“ Die Angehörigen würden auch mal Geschichten von der Oma, dem Partner oder der Schwester erzählen. „Das ist wichtig für sie, dass sie das mal loswerden. Das gibt der klinische Alltag sonst nicht her.“
Als Blaeses Mann schließlich verlegt wurde, habe sie dem neuen Krankenhaus so eine Sprechstunde sofort vorgeschlagen. „Dort hat man dieses Angebot aber leider nicht gehabt.“ Ihr Mann ist letztendlich gestorben. Aber Blaese hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Idee zu verbreiten. „Dass ich diese Zeit überstanden habe, lag an dieser Angehörigen-Telefonsprechstunde.“
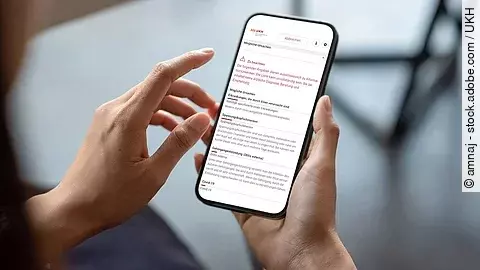




Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen