
In Jena arbeitet ein interdisziplinäres Forscherteam an einem Verfahren, das Chirurgen bei einer Tumoroperation kontinuierlich visuell und haptisch unterstützt. Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius, Direktor der Klinik für HNO-Heilkunde am Universitätsklinikum Jena (UKJ) und Koordinator des Projektteams, erläutert kma das Vorhaben.
Mit Ihrem neuen Unterstützungssystem möchten Sie den Tumorrand millimetergenau darstellen. Warum reicht die aktuelle Bildgebung hierfür nicht aus?
Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius: Das hat mehrere Gründe. In der Kopf-Hals-Chirurgie müssen wir die Tumorgrenzen millimetergenau erkennen können. Selbst eine hochauflösende Bildgebung, zum Beispiel eine kernspintomographische Aufnahme, kann die tatsächliche Tumorausdehnung nur mit einer Unsicherheit von bis zu ein paar Millimetern darstellen. Hinzu kommen weitere technische Begrenzungen. Durch Entzündungsreaktionen beispielsweise in der Umgebung eines Tumors können wir die Grenze zum gesunden Gewebe nicht genau erkennen.
In dem Moment, in dem ein Chirurg in den Körper hineinschneidet, verändert sich dort augenblicklich die Situation.
Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Aktualität der Bildgebung: In dem Moment, in dem ein Chirurg in den Körper hineinschneidet, verändert sich dort augenblicklich die Situation. Wenn es durch den Schnitt zu einer Blutung oder Schwellung kommt, verschiebt sich die Lage des Tumors gegenüber der präoperativen Bildgebung um wenige Millimeter. Eine weitere technische Limitation: Mit zunehmender Eindringtiefe wird die Navigation im Körper ungenauer.
Wie funktioniert das System, an dem Sie arbeiten?
Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius: Wir verwenden biophotonische Verfahren. Das heißt, wir applizieren Licht auf das Gewebe und können dadurch hochauflösende Analysen der Gewebeoberfläche vornehmen. Abhängig vom verwendeten Verfahren erreichen wir eine Auflösung bis zur Molekülebene. Schon jetzt sind wir in der Lage, in einem sehr dünnen Gewebeschnitt hochpräzise zwischen Tumor, Gewebe, Entzündung oder anderen Gewebstypen zu unterscheiden. Im Moment arbeiten wir am Transfer vom Gewebepräparat in den Operationssaal.
Zur Person
Prof. Dr. med. Orlando Guntinas-Lichius ist Direktor der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Jena. Bevor er einen Ruf an die Universität Jena erhielt, arbeitete er an der Universität Köln, wo er auch Medizin studiert hat. Seit 2016 ist er Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie.
Welche Herausforderungen gibt es bei diesem Transfer?
Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius: Je hochauflösender ein Verfahren ist, desto zeitaufwendiger ist es. Im Operationssaal aber muss alles sehr schnell gehen. Wir stehen daher vor der Herausforderung, weniger präzise zu messen und dennoch valide Informationen zu erhalten. Hinzu kommt, dass wir relativ große Flächen untersuchen, was in so kurzer Zeit hochauflösend nicht möglich ist. Wir verwenden deshalb verschiedene spektroskopische Verfahren – sogenanntes multimodales Imaging. Zunächst untersuchen wir eine große Fläche weniger hochauflösend und konzentrieren uns dann mit einer hochauflösenden Technik auf die Stelle, auf die es ankommt – den Tumorrand.
Als eine hochauflösende Technik bietet sich die Raman-Spektroskopie an. Mit ihr ist es sogar möglich, einzelne Bildpunkte (Pixel) zu messen. Allerdings benötigen wir dafür an einem Gewebeschnitt immer noch zwölf Sekunden. Wir arbeiten daher an einer Lösung, die sich tatsächlich für den Operationssaal eignet. Hierbei spielen die für die Messungen und Berechnungen eingesetzte Hard -und Software sowie die Algorithmen für die Verarbeitung eine wichtige Rolle.
Wie setzen Sie die spektroskopische Information für den Chirurgen um?
Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius: Die von uns entwickelte Technik soll den Operateur so führen, dass er in Sekundenschnelle optimale Entscheidungen treffen kann. Das heißt, es wird eine Visualisierung geben, die die Tumorgrenzen für den Arzt darstellt. Hierzu haben wir im Projekt eine eigene Arbeitsgruppe für die Visualisierung eingesetzt. Ähnlich wie bei der Navigation im Straßenverkehr müssen die Informationen für die Navigation ständig aktualisiert werden.
Wie ich bereits erläutert habe, verändern sich diese Werte nach jedem Schnitt. Hinzu kommt der Transfer vom Gewebeschnitt auf unprozessiertes, dickeres Gewebe im Patienten. Das bedeutet, dass wir die von uns entwickelten Algorithmen an die Szenarien im lebenden Körper und vor allem im dickeren Gewebe anpassen müssen.
In welcher Größenordnung können Sie die Tumorgrenze für den Chirurgen darstellen?
Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius: Unser System zeigt den Tumor hochaufgelöst und die Tumorgrenze sogar im Mikrometerbereich an. Wenn ich mit der Hand schneide, bewege ich mich in einem Präzisionsbereich von mehreren Millimetern. Die hohe Genauigkeit unseres Verfahrens bietet sich geradezu an für die robotische Chirurgie. Dort liegt die Präzision der Instrumentenführung im Millimeterbereich und die Technik wird in Zukunft noch präziser.
Bislang spielt die Robotik in der Neurochirurgie noch keine Rolle, weil sie dem Chirurgen noch kein haptisches Feedback geben kann. Während einer Operation spüre ich mit meinen Instrumenten oder mit meinen Fingern, wie sich das Gewebe anfühlt und entscheide danach die Schnittführung. Dabei geht es nicht nur um die Tumore, sondern auch um die Schonung von wichtigen Strukturen.
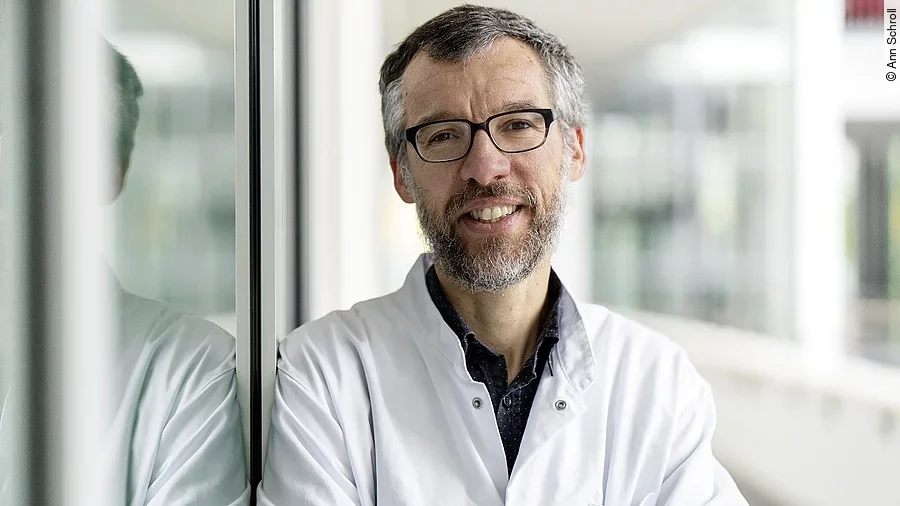
Die hohe Genauigkeit unseres Verfahrens bietet sich geradezu an für die robotische Chirurgie. Dort liegt die Präzision der Instrumentenführung im Millimeterbereich und die Technik wird in Zukunft noch präziser.
Sie entwickeln im Projekt ein eigenes haptisches Verfahren. Worin unterscheidet es sich vom Ansatz der Robotikhersteller?
Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius: Die Unternehmen versuchen, das Bild, das sie dem Chirurgen von der Operationsstelle zeigen, mit einer automatischen Bildanalyse zu verknüpfen. Ihr Ziel ist es, die Gewebetextur zu analysieren, um zum Beispiel ein Blutgefäß zu erkennen. Der Chirurg soll dann so geleitet werden, dass er seinen Arm nicht in eine Richtung bewegt, in der er auf ein Gefäß treffen würde. Wir wollen die optische Sensorik zur Analyse der Gewebstextur nutzen, um zwischen Tumor- und Nicht-Tumor-Gewebe zu unterscheiden und auch, um haptische Eigenschaften zu messen.
Vorarbeiten haben aber gezeigt, dass dies wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Wir entwickeln deshalb im Projekt zusätzlich zum optischen Sensor auch einen biomechanischen. Über einen Stift, der das Gewebe berührt, wollen wir die Gewebssteifheit in eine haptische Information umsetzen, die dann auch fühlbar gemacht oder visualisiert werden soll. Unser Gesamtkonzept geht durch diesen zusätzlichen biomechanischen Ansatz über die automatische Bildanalyse hinaus. Der Sensor, den wir bauen werden, beinhaltet letztendlich zwei verschiedene Sensortechnologien, die wir mit oder ohne Robotik betreiben können.
Sie verwenden für den optischen Sensor nicht nur die Ramanspektroskopie. An welchen weiteren Techniken arbeiten Sie?
Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius: Wir verwenden multimodales Imaging. Das heißt, dass wir verschiedene spektroskopische Verfahren gemeinsam nutzen und mit einer einzigen Messung sogar unterschiedliche Parameter messen können. Dabei verwenden wir auch Verfahren, die im nahen Infrarotbereich (NIR) arbeiten. Das Besondere daran ist, dass wir dabei auf den Einsatz von Fluoreszenzmarkern verzichten. Bislang ist es in der Neurochirurgie üblich, bei Messungen im nahen Infrarotbereich (NIR) dem Patienten einen Fluoreszenzfarbstoff zu injizieren.
Das Besondere daran ist, dass wir dabei auf den Einsatz von Fluoreszenzmarkern verzichten.
Beim Transfer unserer Technik vom Gewebeschnitt auf den Patienten stellt uns die begrenzte Eindringtiefe des Lichts vor eine Herausforderung. Das lösen wir, indem wir die Messung ständig wiederholen. Deshalb benötigt unsere Verfahren eine hohe Geschwindigkeit. Sobald wir eine Messung von einem Gewebsstück machen liefert uns der Algorithmus in relativ kurzer Zeit eine Information über die Lage des Tumors und dessen Randbereich. Wir tragen dann mit einem hochauflösenden Laserverfahren diese sehr feinen Gewebsschichten ab und wiederholen die Messung. Diesen Vorgang wiederholen wir mehrmals.
Wie aufwendig ist das Training der Algorithmen?
Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius: Aufwendig ist nicht das Training, sondern das Sammeln der Daten für das Training. Hierfür benötigen ein relativ großes Netzwerk von Kliniken mit Kopf-Hals-Tumoren, die natürlich dann sehr standardisiert diese Gewebsaufnahmen machen und uns zur Verfügung stellen. Die Algorithmen, die wir bereits bei Kopf-Hals-Tumoren anwenden, basieren auf Hunderten von Tumoren. Das ist im Bereich des maschinellen Lernens immer noch sehr wenig. Die im Projekt beteiligten KI-Experten sind jedoch darauf spezialisiert, Algorithmen mit geringen Datenmengen zu trainieren.

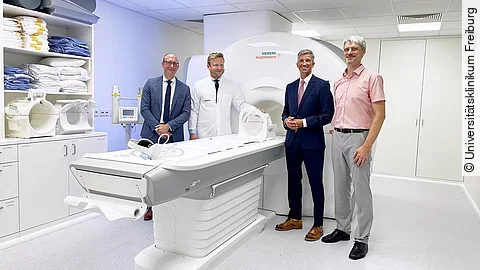



Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen