
Laut der Roland Berger Krankenhausstudie 2025 liegt der Investitionsbedarf der Kliniken bei rund 130 Milliarden Euro – weit mehr, als der geplante Transformationsfonds mit 50 Milliarden Euro abdeckt. Dieser soll über zehn Jahre hinweg zu gleichen Teilen von Bund und Ländern finanziert werden. Die Frage, wie die verbleibenden 80 Milliarden Euro aufgebracht werden sollen, ist bislang unbeantwortet und stellt die Krankenhausträger vor existenzielle Herausforderungen.
Die Finanzierungslücke: Ein strukturelles Problem
Die duale Krankenhausfinanzierung – Betriebskosten durch Krankenkassen, Investitionen durch Bundesländer – erweist sich zunehmend als dysfunktional. Viele Bundesländer kommen ihrer Investitionsverpflichtung seit Jahrzehnten nur unzureichend nach. Mit der Einführung des Pflegebudgets wurde die Möglichkeit, Abschreibungen oder Investitionen aus dem operativen Cashflow zu finanzieren, stark eingeschränkt. Die Folge: Kliniken müssen notwendige Investitionen, Modernisierungen und Digitalisierungsvorhaben aus Eigenmitteln stemmen oder aufschieben.
Der Fonds ist ein Instrument zur Umstrukturierung, nicht zur Sanierung.
Der Transformationsfonds kann hier nur bedingt Abhilfe schaffen: Seine Mittel sind begrenzt und an strenge Kriterien gebunden. Förderfähig sind etwa die Bildung regionaler Krankenhausverbünde, die Umwandlung von Kliniken in sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen oder die Implementierung spezialisierter Zentren. Instandhaltung und Substanzerhalt bleiben dagegen außen vor – der Fonds ist ein Instrument zur Umstrukturierung, nicht zur Sanierung.
Öffentliche vs. private Träger: Unterschiedliche Strategien
89 Prozent der öffentlichen Kliniken schreiben laut der Roland Berger Studie rote Zahlen, während private Häuser deutlich besser abschneiden. Diese Divergenz spiegelt sich auch in den Strategien der Träger wider.
Öffentliche Krankenhäuser sind oft auf kommunale Zuschüsse angewiesen. Viele Städte und Landkreise verschieben andere Investitionsvorhaben, um ihre Kliniken zu stützen. Doch diese Mittel sind begrenzt und die politische Bereitschaft zur dauerhaften Subventionierung sinkt. Fusionen oder Standortschließungen gelten zunehmend als unausweichlich – teils getrieben von Landespolitik, teils aus schierer Not.
Private Träger hingegen agieren flexibler. Im Gegensatz zu öffentlichen Häusern investieren sie verstärkt aus Eigenkapital und setzen auf Spezialisierung und Effizienzsteigerung. Private Anbieter nutzen die Reform als Chance zur Marktpositionierung: Sie bündeln Leistungen, schließen unrentable Standorte und investieren gezielt in profitable Fachbereiche.
Konsolidierung und neue Versorgungslogik?
Die Krankenhausreform und die Förderlogik des Transformationsfonds begünstigen eine Konsolidierung der Versorgungsstrukturen. Regionale Krankenhausverbünde, Leistungsgruppen und Versorgungsstufen könnten zu einer stärkeren Differenzierung der Angebote führen.
Ein mögliches Zukunftsszenario: Öffentliche Häuser sichern die wohnortnahe Grund- und Notfallversorgung, während spezialisierte Behandlungen zunehmend von privaten Zentren übernommen werden. Die Reformpläne des Bundes mit bundeseinheitlichen Versorgungsstufen und Vorhaltefinanzierung für bedarfsnotwendige Leistungen sollten diese Entwicklung unterstützen
Spezialisierung gilt als Schlüssel zu höherer Versorgungsqualität. Private Kliniken positionieren sich als Zentren für komplexe Eingriffe – etwa in der Herzchirurgie, Onkologie oder Neurologie. Öffentliche Häuser hingegen sichern die flächendeckende Versorgung, insbesondere in ländlichen Regionen. Diese Arbeitsteilung könnte langfristig zu einer funktionalen Trägerdifferenzierung führen.
Risiken und offene Fragen
Doch die Konsolidierung birgt auch Risiken. Fusionen und Übernahmen können zu regionalen Monopolen führen. Der Transaktionsmarkt zeigt bereits erste Tendenzen, dass Zusammenschlüsse aus finanzieller Not oder strategischem Kalkül erfolgen. Kartellrechtliche Prüfungen greifen bislang kaum.
Zudem ist unklar, wie sich die neue Versorgungslogik auf Erreichbarkeit und Qualität auswirken wird. Zwar setzt die Reform auf Telemedizin und sektorenübergreifende Kooperationen, doch ist fraglich, ob diese die entstehenden Versorgungslücken schließen können, die gerade in ländlichen Gebieten drohen, wenn kleinere Häuser schließen und die Wege zu spezialisierten Zentren länger werden.
Wer schließt die 80-Milliarden-Lücke?
Wo kommen also die fehlenden 80 oder gar 130 Milliarden Euro her, damit der Investitionsbedarf deutscher Kliniken gedeckt ist? Die Länder kommen schon jetzt nicht ihren Verpflichtungen ausreichend nach. Während sich die Mittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) seit 1973 nominal verdoppelt haben, hat sich das Bruttoinlandsprodukt im gleichen Zeitraum versiebenfacht.
Die Schere zwischen tatsächlichem Investitionsbedarf und den zur Verfügung gestellten Mitteln geht seit Jahren immer weiter auseinander.
Die Schere zwischen tatsächlichem Investitionsbedarf und den zur Verfügung gestellten Mitteln geht seit Jahren immer weiter auseinander: Im Jahr 2022 beliefen sich die Investitionsmittel zwar auf 3,55 Milliarden Euro, aber ihr Anteil an den Krankenhauserlösen (ohne Universitätskliniken) betrug nur noch 3,5 Prozent – 1991 waren es hingegen noch 9,4 Prozent. Allein, um dringend notwendige Bestandsinvestitionen sicherzustellen, müsste dieser Anteil mittelfristig auf das Doppelte steigen.
Da der Transformationsfonds im Wesentlichen konkrete strukturelle Veränderungen der Krankenhauslandschaft finanzieren soll, trägt auch dieser nicht dazu bei, das Problem der chronischen Unterfinanzierung von Bestandsinvestitionen zu lösen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die duale Finanzierung insgesamt noch zeitgemäß ist: Der Bund beteiligt sich bereits mit 25 Milliarden Euro, ursprünglich sogar zulasten der gesetzlichen Krankenkassen. Denkbar wäre etwa ein Investitionskostenzuschlag auf die Vorhaltevergütung. Dies würde aber auch die Finanzierung von Behandlungs- und Investitionskosten nahezu vollständig in die Verantwortung der gesetzlichen Krankenversicherung legen. Ohne Kompensationen würde dies unweigerlich zu deutlich höheren Sozialversicherungsausgaben führen.
Fazit: Zwischen Umbau und Unsicherheit
Die bestehende Finanzierungslücke von Investitionskosten muss auch weiterhin durch Einsparungen an anderer Stelle – insbesondere im Bereich der Betriebs- und Sachkosten – geschlossen werden. Die daraus resultierenden Risiken für Krankenhäuser und Patienten sind ebenso vielfältig wie dramatisch. Dazu zählen – trotz des Transformationsfonds – eine unzureichende Anpassung der Krankenhäuser an medizinische Entwicklungen und Fortschritte.
Hinzu kommen kompensatorische Mengenausweitungen bei Krankenhausbehandlungen ohne medizinische Notwendigkeit und insbesondere eine zunehmende Belastung des Jahresergebnisses durch Abschreibungen und Zinsen infolge eigenfinanzierter oder darlehensgestützter Investitionen.
Aufgrund der ohnehin schon dramatischen Lage der Krankenhäuser führt dies bei einer veralteten Infrastruktur zu noch größeren Defiziten oder gar zu Insolvenzen.
Die duale Krankenhausfinanzierung aus Geldtöpfen, deren Füllstand Ergebnis diffuser politischer Meinungsbildung und Entscheidungsprozessen ist, wird unverändert ein Hemmschuh für die Schaffung einer stabilen Finanzlage der Krankenhäuser bleiben Eine Verbesserung ist nur durch klare politische Verantwortlichkeiten möglich – ob dies auch der Versorgungsqualität dient, bleibt jedoch fraglich.

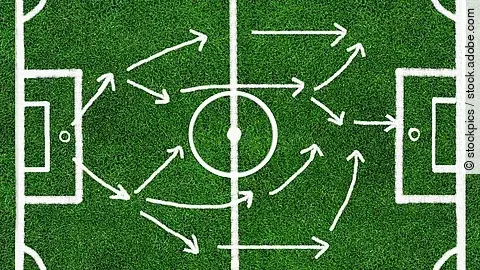






Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen